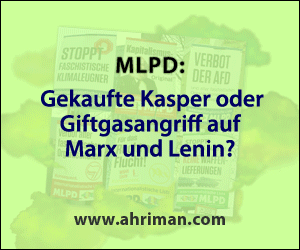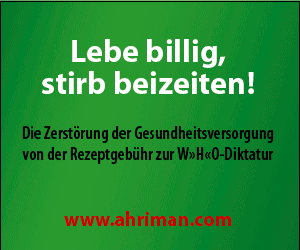Ja wieder einmal das Thema Windräder, nach den zahllosen Studien und Beweisen der Umweltschädlichkeit selbiger, hatte man nun die Windparks und deren „Effizienz“ unter die Lupe genommen.
Man gelangte zur Erkenntnis, je mehr Rotoren also auf engem Raum beisammen stehen, desto geringer sind die Erträge der Einzelnen.
Windkraftausbau beeinflusst lokales Klima
Windparks verändern fraglos die lokalen Windverhältnisse, denn sie entziehen der Luft Bewegungsenergie. Für dieses Phänomen, das angesichts der Ausbaupläne in Deutschland zunehmend relevant wird, hat sich inzwischen die Bezeichnung „Windklau“ etabliert wie auch Bernward Janzing für die taz berichtet hatte.
Dieses Thema könnte freilich für die Anlagenbetreiber aus wirtschaftlichen Gründen relevant werden. Daneben interessieren sich längst auch Meteorologen und Meeresforscher für die Auswirkungen der Rotoren auf die Luft, das Wasser und Boden.
Projektbetreiber von Windparks wissen jedoch schon lange, dass ihre Windräder ausreichend Abstand brauchen, um sich gegenseitig nicht zu viel Wind zu stehlen. An Land ist daher ein Mindestabstand von fünf bis sieben Rotordurchmessern in Hauptwindrichtung Standard, in den deutschen Windparks auf dem Meer sind es sieben bis zehn Rotordurchmesser. Doch dort reichen die Auswirkungen jedoch weit über die Parks hinaus.
„Windklau“
„Bei großen Offshore-Windparks können im Nachlauf also die Strömung hinter den Windturbinen, im Mittel bis zu 30 Kilometer weit Ertragsverluste nachgewiesen werden“, erklärt Martin Dörenkämper, Energiemeteorologe am Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES in Oldenburg. Bei speziellen Wetterbedingungen, besonders deutlich bei kaltem Meer und warmer Luft, könnten sich Effekte auch auf 120 bis 150 Kilometer Entfernung noch messen lassen. Da diese Konstellation aber nicht permanent auftritt, ist sie freilich für die Erträge wenig relevant.
Besonders deutsche Offshore-Windparks sind vom „Windklau“ betroffen, da man hier auf eine sehr hohe Leistungsdichte setzt. Pro Quadratkilometer würden in den deutschen Seegebieten zumeist 8 bis 10 Megawatt an Kapazitäten installiert, sagt Dörenkämper. In Dänemark arbeite man mit nur 4 bis 5 Megawatt.
Zunehmende Erkenntnis des „Scheiterns Grünen Wahns“
Nun jedoch rückt zunehmend die Erkenntnis ins Bewusstsein, dass ein starker Ausbau der Offshore-Windkraft die Erträge der einzelnen Anlagen mindern wird. „Grüner Wahn“ trifft somit erneut auf die nüchterne Realität der Natur.
Der allseits bekannte Thinktank Agora Energiewende im „Fahrwasser“ Habeckscher Grünideologie, schrieb bereits im Jahr 2020 in einer Studie, dass „die Zahl der Volllaststunden der Offshore-Windparks deutlich sinken“ werde, wenn eines Tages in der Deutschen Bucht 50 bis 70 Gigawatt an Rotoren errichtet sind. Axel Kleidon, Physiker und Meteorologe am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, kann dies sogar quantifizieren, „70 Gigawatt würden den Ertrag um bis zu 40 Prozent reduzieren.“
Neben den „üblichen“ Branchenakteuren haben längst auch Geowissenschaftler die regionalen Konsequenzen der Windenergie im Blick. Nachgewiesen sind beispielsweise bereits Auswirkungen auf die Meereswellen. „Die Wellenhöhe im Nachlauf des Windparks nimmt um bis zu fünf Prozent ab“, sagt Ute Daewel, Geowissenschaftlerin am Helmholtz-Zentrum Hereon in Hamburg. 20 Kilometer windabwärts könne die Wellenhöhe noch bis zu ein Prozent verringert sein. Mittels Satelliten sind solche Veränderungen nachweisbar.
Weitere Folgen
Mit der Windgeschwindigkeit nehmen auch Meeresströmungen ab, was die Durchmischung im Ozean massiv beeinträchtigt. „Modellsimulationen zeigen, dass Strömungsgeschwindigkeiten im Bereich der Nachläufe bis zu zehn Prozent reduziert werden“, erklärt Daewel. Fraglos wird auch das Wetter durch die Windernte beeinflusst. Naveed Akthar, Experte für die Modellierung der Atmosphäre am Hereon, erläutert, dass durch eine verstärkte vertikale Durchmischung die Luftschichten unterhalb der Nabenhöhe trockener und wärmer würden. In Offshore-Parks habe man in zwei Metern Höhe einen Temperaturanstieg von etwa 0,25 Grad festgestellt, in Nabenhöhe hingegen einen Temperaturrückgang von 0,15 Grad.
Auch nehme die Bewölkung im Bereich über den Windkraftanlagen zu, was zu höheren Niederschlägen über den Windparks und geringeren Niederschlägen in der Windrichtung führe. Wie sich die für 2050 in der Nordsee geplanten Windparks auf die Niederschläge an Land auswirken, sei eine der wichtigsten noch ungeklärten Fragen.
Somit ist erneut belegt, dass auch die Nutzung grünideologischer Windkraft, wie jeder Eingriff in ein Ökosystem Folgen hat.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.